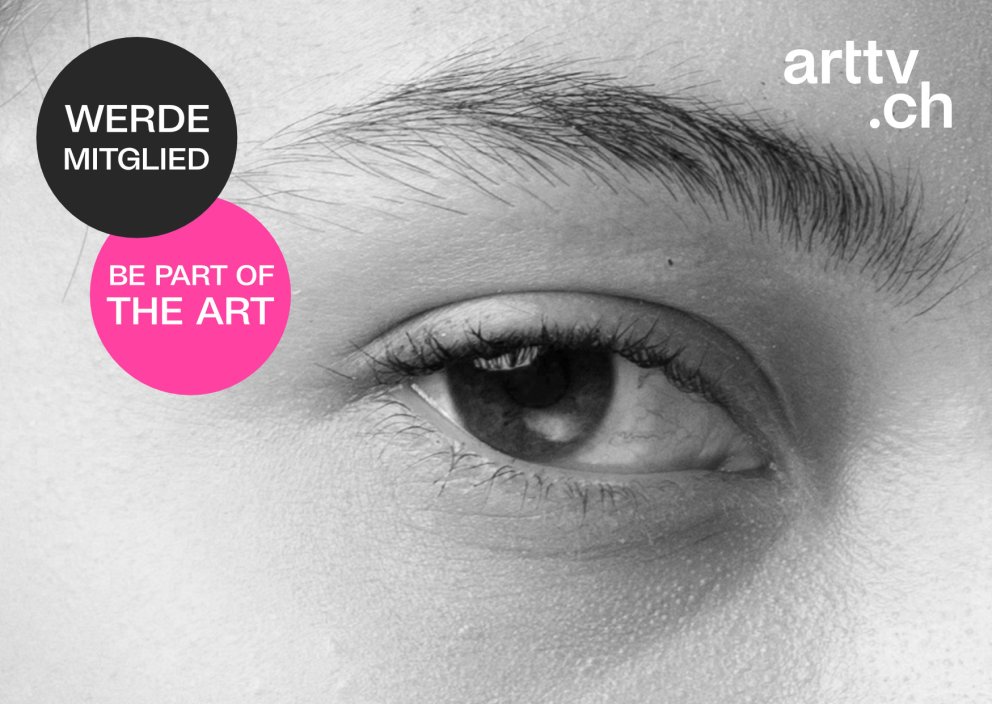Toni, ein attraktiver Priester, schwängert in der Schweizer Provinz der Fünfzigerjahre mehrere Frauen, bis er nach dem vierten Kind aus dem Amt scheidet. Seine Kinder lernen sich erst nach seinem Tod kennen. Dokumentarfilmer Miklós Gimes nimmt sich in «Unser Vater » ihrer Geschichten an. Im Interview mit Geri Krebs erzählen der Regisseur und eine der Töchter, wie sie alle zusammenkamen.
Interview Miklós Gimes und Monika Gisler | Unser Vater
«Du, Miklós, bist ohne zu werten, an die Geschichte meines Vaters herangegangen.» Monika Gisler
«Miklós hast es mit seinem Film geschafft, meinen Vater, den ich zu seinen Lebzeiten immer gern hatte, nicht als Scheusal darzustellen, sondern vielmehr als triebgesteuerten Mann, dem es an Unrechtsbewusstsein fehlte und der seine Stellung und seine Wirkung auf Frauen schamlos ausnutzte.» – Monika Gisler
Regisseur Miklós Gimes und Protagonistin Monika Gisler im Interview
Von Geri Krebs
Herr Gimes, als Sie erstmals von Toni Ebnöther hörten – dem Priester, der mit mindestens vier Frauen Kinder gezeugt hatte – waren Sie skeptisch, ob diese Geschichte für einen Dokumentarfilm geeignet wäre. Warum?
Miklós Gimes: Meine erste Reaktion war damals, 2016, so ungefähr: Man hat es jetzt gesehen … all diese Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Es war die Zeit, als man darüber fast täglich in den Medien berichtete. Etwa der Fall des Wiener Erzbischofs oder jener des australischen Kardinals, der unzählige Kinder sexuell ausgebeutet hatte. In jenem Jahr gewann der Hollywoodfilm «Spotlight» den Oscar als bester Film, der von der Aufdeckung eines – real existierenden – Netzwerkes pädokrimineller Kirchenleute in den USA erzählte.
Was hat Sie dann dazu bewogen, Ihre Meinung zu ändern?
Als ich mich erstmals mit den sechs Kindern von Ebnöther traf, merkte ich, dass da mehr war als «nur» das Thema eines katholischen Priesters, der Frauen sexuell ausgebeutet hatte. Es ging um Geheimnisse, die es wohl in jeder Familie gibt. Ausserdem ging es um eine Zeit, in der es viel mehr als heute wichtig war, den Schein nach aussen zu wahren. Im Laufe der Dreharbeiten, die sich über einen Zeitraum von über zwei Jahren erstreckten, machte ich dann noch die für einen Dokumentarfilmer beglückende Erfahrung, mit drei der betroffenen Frauen noch sprechen zu können. Es war diese letzte Gelegenheit. Zwei von ihnen waren schon hoch betagt und starben bald nach unseren Treffen. Heute leben nur noch die Mutter von Monika Gisler und die Mutter der Geschwister Adrian und Daniela (der zwei jüngsten der von Toni Ebnöther gezeugten Kinder, Anm. d. Redaktion).
Sie, Frau Gisler, sind eines dieser sechs Kinder. Im Gegensatz zu Ihren fünf Halbgeschwistern wussten Sie schon früh, wer Ihr leiblicher Vater war. Sie behielten das aber jahrzehntelang für sich. Warum schwiegen Sie?
Monika Gisler: Also, ich muss etwa neun oder zehn Jahre alt gewesen sein, als meine Mutter mich an einem Sommerwochenende aus dem Kinderheim abholte und mit mir in dieses Berghotel Sunneschy in Saas im Prättigau reiste. Ich bekam dort oben ein Getränk und ein Kägifret und meine Mutter unterhielt sich sehr lange mit dem Mann, der offenbar der Besitzer war. Auf dem Heimweg im Zug sagte sie mir dann irgendwann: Dieser Mann ist dein Vater, aber du darfst niemand davon erzählen.
Was passierte dann?
Wenig später heiratete meine Mutter dann einen anderen Mann, ich durfte fortan bei ihr und diesem Mann wohnen. Und dieser Mann, den ich fortan ‹Dädi› nannte, nahm mich wie seine Tochter an und ich hatte stets ein gutes Verhältnis zu ihm. Ich hatte aber auch ein herzliches Verhältnis zu Ebnöther, meinem leiblichen Vater. Wir waren regelmässig in den Sommerferien und oft auch im Winter zum Skifahren bei ihm – meist mit der ganzen Familie, mein Dädi inklusive. Er und Ebnöther verstanden sich gut. Die beiden scherzten sogar mit mir, sagten: Du hast halt zwei Väter. Für mich war das ganz natürlich, ich sah aber auch keinen Grund, anderen davon zu erzählen.
Wann änderte sich das?
Eigentlich erst nach 2011, nach dem Tod von Toni Ebnöther. Im Film erzähle ich von seiner Beerdigung, die ein Schlüssel für meine Geschichte war. Ich wusste ja, dass viele Verwandte kommen werden. Und ich wollte wissen, wer all diese Leute waren. So ging ich also am Ende der Beerdigung auf alle Anwesende zu, fragte: Bist du verwandt mit Toni? – ich bin übrigens seine Tochter. So kam ich dort der Wahrheit auf die Spur und begann von da weg, weiter zu recherchieren.
Sie berichten im Film dann auch, wie die Trauerredner an der Beerdigung die Geschichte krass verfälschten und behaupteten, Ebnöther habe sich mit der Kirche überworfen, weil er zu viel Musik gemacht hatte. Es wird andererseits aber auch nicht klar, wie und unter welchen Umständen er tatsächlich seine Stelle als Priester verlor …
Miklós Gimes: Ich möchte dazu etwas klarstellen. Als Priester wurde er nie offiziell entlassen, denn eine Entlassung aus dem Priesteramt kann nur der Papst vornehmen. Das hätte über den zuständigen Bischof laufen müssen, in diesem Fall den Bischof von Chur. Und dieser hätte mitteilen müssen: He, wir haben da einen, der hat vier Kinder (zwei weitere hat er ja erst gezeugt, als er nicht mehr als Priester tätig war). Also, der Bischof von Chur hütete sich wahrscheinlich, denn in dem Moment, wo Ebnöther offiziell seine Priesterweihe verliert, kommt es zum Gerede.
Das wäre auch für die Kirche schwierig gewesen.
Ja, folglich behielt man alles unter dem Deckel, man handhabte es von Seite der Kirchenoberen, so, dass man Ebnöther erst versetzte und ihn dann, als er erneut übergriffig wurde, zu ‹Exerzitien› für ein Jahr in ein Kloster nach Fribourg schickte. Danach erhielt er nur noch Vikariate als Religionslehrer und bald darauf quittierte er von sich aus den Dienst. Und schliesslich erwarb er dann – übrigens auch wieder mit finanzieller Hilfe mehrerer Frauen – dieses Berghotel in Saas.
Monika Gisler: Er hat offenbar auch selber grossen Wert darauf gelegt, dass er als Priester aus dem Amt nie entlassen worden war. Was sich nach seinem Tod zeigte, als man im Hotel in einer Schublade noch, schön zusammengefaltet, sein Priestergewand fand.
Herr Gimes, ihr Film wird getragen von einem sichtbar grossen Vertrauen, das alle Protagonist:innen zu Ihnen haben. Wie haben Sie das geschafft?
Miklós Gimes: Schön, dass Sie das so sehen. Für mich war klar, dass der Film weitgehend von den Zeugnissen der vier Töchter und der zwei Söhne Ebnöthers abhängen würde. Denn trotz intensiver Recherche mussten wir feststellen, dass von Ebnöther keine Filmdokumente existieren, sondern nur die paar Fotografien und Tondokumente, die man im Film sieht und hört. Erschwerend kam noch hinzu, dass die Witwe von Toni Ebnöther – die eine wichtige Person gewesen wäre – nichts mit dem Filmprojekt zu tun haben wollte. Sie trat erst spät in sein Leben, er hatte sie mit siebzig geheiratet.
Frau Gisler, warum haben Sie im Film mitgewirkt?
Monika Gisler: Ein Schlüsselerlebnis für meinen Entschluss, im Film mitzuwirken, war der Film «Mutter» (2003), den ich vor einigen Jahren gesehen hatte. Mich hatte dort sehr beeindruckt, wie einfühlsam du, Miklós, darin mit der komplexen Geschichte deiner Mutter und auch deiner eigenen umgegangen bist. Von da her hatte ich von Beginn weg ein gutes Gefühl, dass du, ohne zu werten, an die ganze Geschichte von mir und meinem Vater herangehen würdest. Du hast es nun mit dem Film geschafft, meinen Vater, den ich zu seinen Lebzeiten immer gern hatte, nicht als Scheusal darzustellen, sondern vielmehr als triebgesteuerten Mann, dem es an Unrechtsbewusstsein fehlte und der seine Stellung und seine Wirkung auf Frauen schamlos ausnutzte.