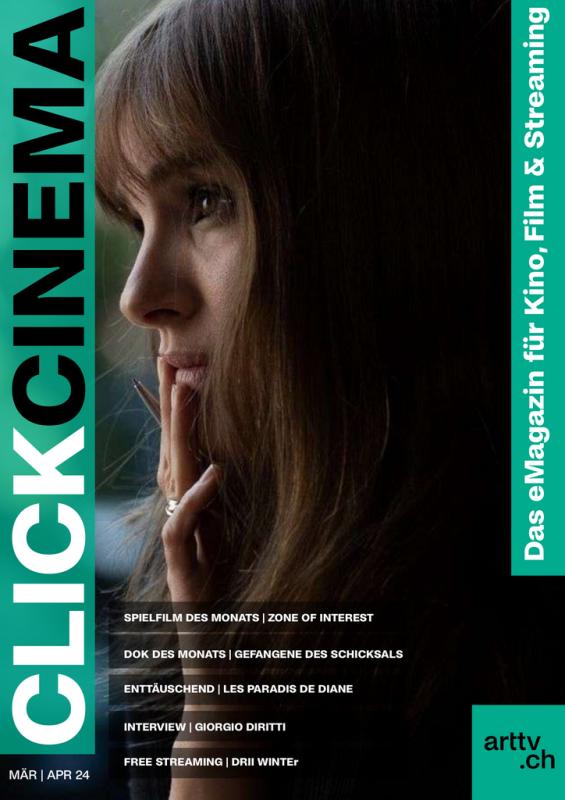Berlinale 2016 | «Aloys» von Tobias Nölle
Der Zürcher Regisseur Tobias Nölle hat mit «Aloys» einen skurrilen Spielfilm geschaffen, der die Einsamkeit der Grossstadt-Neurotiker in einer ganz eigenen unverkennbaren Handschrift erzählt. Der Film sorgte an der Berlinale für viel Gesprächsstoff und gute Kritiken.
Lakonischer Humor
Nach dem Tod seines Vaters führt Aloys Adorn (Georg Friedrich) das gemeinsame Detektivbüro alleine weiter. Mit seiner Videokamera filmt er seinen aufgebahrten Vater, um sich zu Hause die Bilder immer wieder anzusehen. Sowieso filmt er lieber alles aus der Distanz, statt wirklich am Leben teilzunehmen. Freunde hat er keine, ausser der Katze, die ihm der Vater hinterlassen hat, aber deren Namen er nicht einmal kennt. Eines Morgens erwacht er auf der Rückbank eines Busses im Depot, seine Kamera und sein Handy wurden ihm gestohlen, neben sich eine leere Flasche, aus der er sich am Abend zuvor besinnungslos betrunken hatte. Nach dem geheimnisvollen Anruf einer jungen Frau, die offensichtlich im Besitz seiner Dinge ist, wird er fortan vom Beobachter zum Beobachteten. Aloys ist fasziniert von dieser Stimme (Tilde von Overbeck), die ihn auf Trab hält mit einem Wechselbad aus Todessehnsucht und philosophischen Gedanken zur Relativität von Wirklichkeit. Er wagt sich aus seiner Isolation und scheint sogar noch die Liebe zu entdecken. Es entspinnt sich ein Paartanz zwischen Realität und surrealistischen Wachträumen, in denen die Natur in Aloys’ Wohnung dringt, Schafe in Hochhaus-Aufzügen blöken, Telefonkabel sich in Bäumen verheddern.
Stimmen
Keine tröstliche Romantic Comedy wird uns in «Aloys» geliefert, obwohl der lakonische Humor uns vor allzuviel Melancholie rettet. (Valerie Thurner)