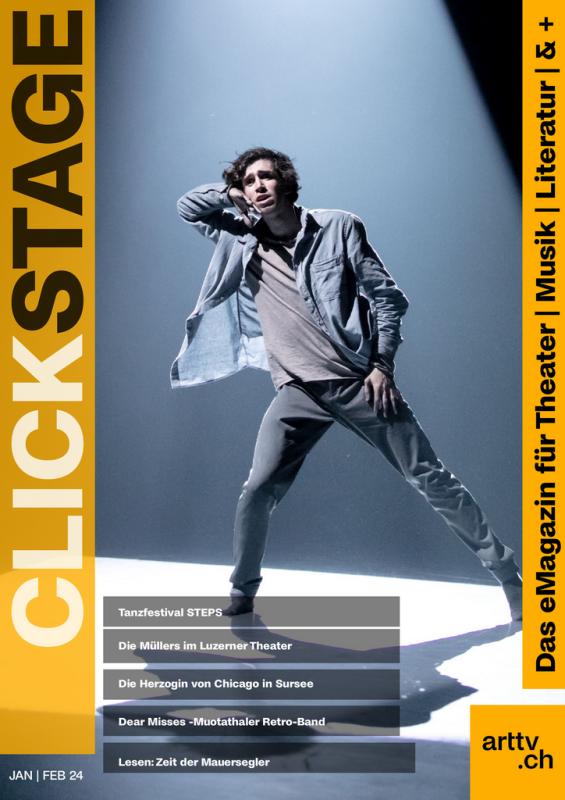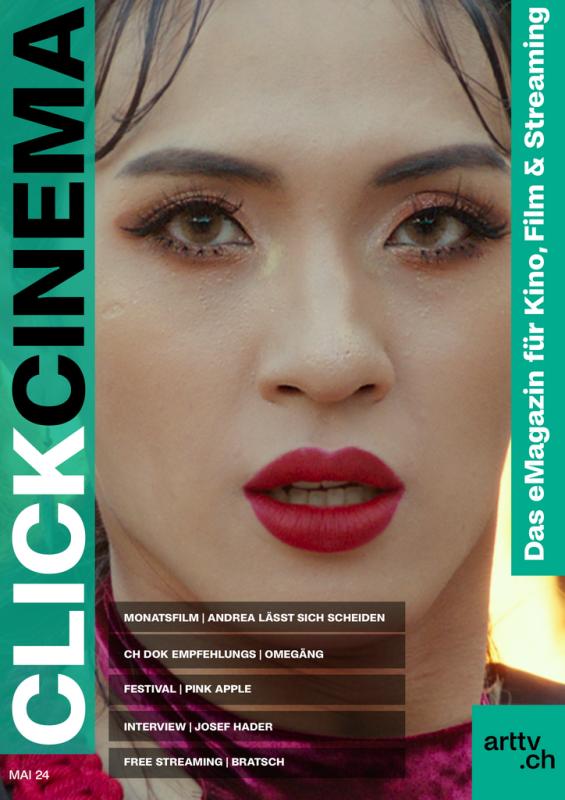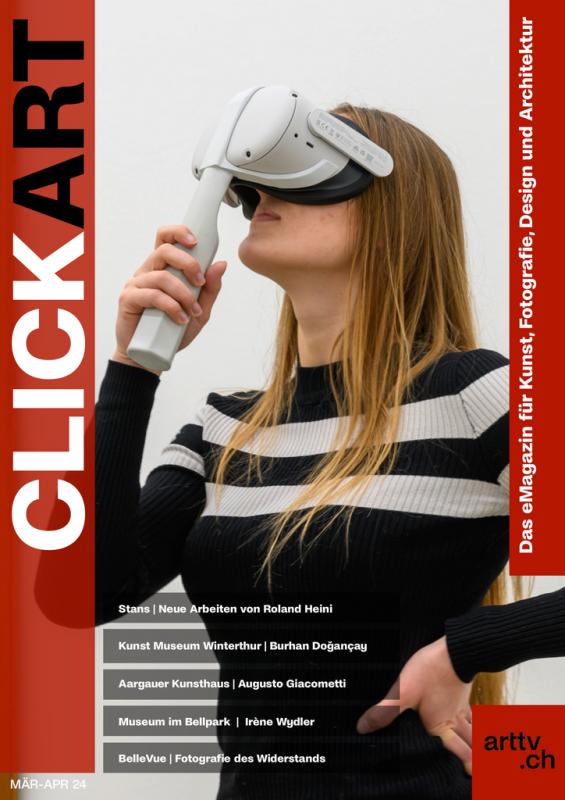Theater Basel | Wozzeck
Im Theater Basel inszeniert der Regisseur Elmar Goerden unter der musikalischen Leitung von Dennis Russell Davies die Oper «Wozzeck» von Alban Berg. Packend und aufrüttelnd!
Kritik
… Die pausenlosen 110 Minuten bieten packendes, aufrüttelndes Musiktheater. Das fängt im Orchestergraben an, wo das Sinfonieorchester Basel unter Dennis Russell Davies Bergs äusserst anspruchsvolle Partitur mit einer transparenten Natürlichkeit und einer subtil nuancierten Dynamik wiedergibt.
Thomas J. Mayer in der Titelpartie erfüllt die enormen Anforderungen an die Rolle trefflich. Sein warm timbrierter Bariton zeichnet den Weg dieses underdogs Mitleid erregend nach. Von seiner stoischen Ruhe bei den Anwürfen seitens des Hauptmanns oder des Doktors, über seine selbst von Marie ausgenützte Gutmütigkeit zum zornigen Aufbegehren, zu Halluzinationen und Wahn. Edith Haller als Marie setzt ihre grosse, voll und ausgesprochen rund klingende Stimme wunderbar kontrolliert ein. Sie vermag ihren Gemütsverfassungen (Gier nach Lebenslust und Vergessen, Schuldbewusstsein, mütterliche Instinkte) mit einer bewegenden Eindringlichkeit Ausdruck zu verschaffen. Ausführliche Kritik auf oper-aktuell
Inhalt
Der einfache Soldat Wozzeck ist ein Getriebener. Er wird mit vielerlei Aggressionen seitens des Hauptmanns, des Doktors und des Tambourmajors konfrontiert, für Versuche am lebenden Menschen missbraucht (um seinen kümmerlichen Sold aufzubessern). Seine Frau Marie (sie hat ein uneheliches Kind mit in die Beziehung zu Wozzeck gebracht) betrügt ihn mit dem Tambourmajor. Wozzeck verfällt immer mehr ins Brüten, wird wahnsinnig. Während eines Spaziergangs bringt er Marie um. Nachdem er sich in einer Kneipe betrunken hat, kehrt er an den Tatort am Weiher zurück. Das Wasser erscheint ihm als Blut. Er watet hinein, bis er ertrinkt. Einige Kinder berichten Maries Knaben vom Tod seiner Mutter, doch dieser spielt stumpf mit seinem Steckenpferd weiter.
Werk
Alban Berg (1885-1935) lernte Büchners Dramenfragment 1914 in Wien kennen. Bereits während seiner Soldatenzeit (1915-18) arbeitete er am Text und vollendete das Werk 1921. Die Uraufführung unter Erich Kleiber wurde geteilt aufgenommen. Begeisterung und radikale Ablehnung der atonalen Tonsprache hielten sich die Waage. 1933 wurde das Werk in Deutschland verboten. Erst nach 1945 tauchte es wieder auf den Spielplänen auf und gehört heute zum Standardrepertoire des Opernbetriebs. Weitere Informationen zu Inhalt und Werk
Für art-tv und oper-aktuell: Kaspar Sannemann, 19. September 2011