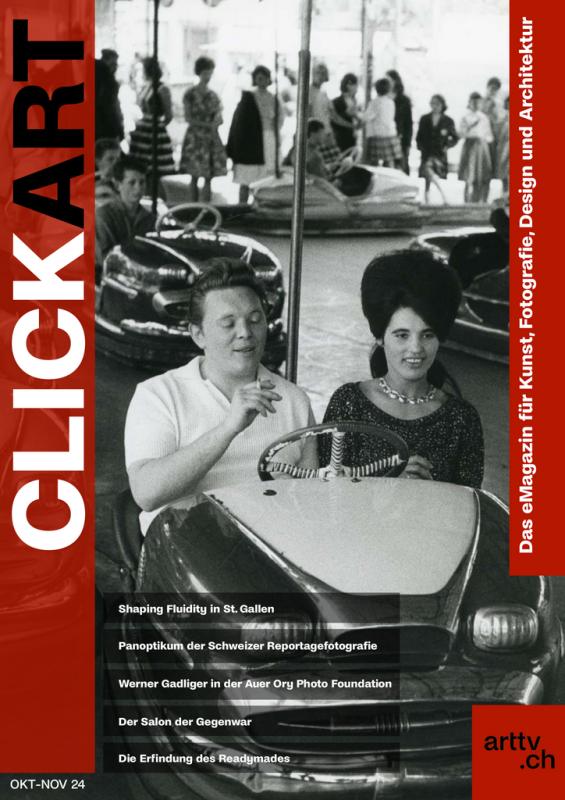Nach dem Computer und Virtualität auch in der Kunst omnipräsent geworden sind, bieten sie auch Angriffsfläche für künstlerische Infragestellung. Gleichzeitig bekommt alles Fassbare, nicht virtuelle einen neuen Reiz und wird etwas besonderes. In der Berner Kunsthalle erarbeiten die Werke von Stefan Burger eine neue Sicht auf die materielle Welt, die gleichzeitig an Arbeiten von Fotopionieren wie Karl Blossfeldt erinnern, ohne dabei der strengen Formalität der Neuen Sachlichkeit zu folgen.
Kunsthalle Bern | Stefan Burger
- Publiziert am 16. Oktober 2017
Weg von der digitalen Kälte: Stefan Burger widmet sich in seiner neuen Ausstellung den analogen chemischen Prozessen der Fotografie.
digital ist nicht immer besser
Nicht wenige Künstler*innen suchen seit einiger Zeit den Widerstand des Materials. Ihre Suche scheint nicht allein der Flucht aus der Langeweile angesichts der allzu vertraut gewordenen Oberflächen einer digital geprägten Welt geschuldet. Es wird darüber hinaus nach dem Moment gesucht, das der eigenen Kontrolle entgleitet, an dem das Material und die verwendeten Werkzeuge sprechend werden und sich in den Entstehungsprozess des Kunstwerkes einschalten. Die künstlerische Suche nach der Zurücknahme der eigenen Autorität berührt die in der Philosophie unter dem Stichwort „spekulativer Realismus“ verhandelte Frage, wie viel menschlicher Zugriff sein muss und dem Planeten Erde gut tut.
Handarbeit
Der Künstler Stefan Burger widmet sich der analogen, an das Labor gebundenen Fotografie aber auch aus ganz anderen Gründen. Vielleicht gab es zunächst auch gar keine Begründung für diesen Schritt und er wollte sich einfach als der verlieren, der er zu sein glaubte oder als den ihn ein Kunstpublikum zu kennen meinte. In jedem Fall führte der Weg über das Labor zu einer neuen Seite von Burger und öffnete eine überraschende Flur in seinem Schaffen, die sich erheblich von dem unterscheidet, was man bisher von ihm zu kennen glaubte. An die Stelle des „berühmten Burger-Humors” tritt jetzt in seinen Bildern der feinsinnige Zauber des pflanzlichen Objekts und in manchen Fotografien eine erstaunliche Tiefe. Es ist eine Tiefe, die immer auch täuscht. Denn es scheint sich auch um beinah magische Oberflächen zu handeln. Flache Tiefen, die sich einer Versprachlichung zwar nicht unmittelbar widersetzen, an denen diese aber immer wieder abgleitet; es lässt sich beschreiben, wie etwa eine noch so kärgliche Pflanzenranke als Wesen mit Charakter auftritt, wie berückend manche Licht- oder Glanzerscheinungen in den Bildern sind, da in der analogen Fotografie eine andere Mannigfaltigkeit erreicht werden kann als in der digitalen; es liesse sich auch über die chromatischen Auren, die durch chemische Prozesse erzeugten Stimmungen sprechen. Doch der Versuch der Versprachlichung formaler Erscheinungsformen, der Versuch, das Material in Sprache zu übertragen, stösst an Grenzen. Denn was vermag die Sprache der Intensität dieser Bilder hinzuzufügen? Ihre Wirkungskraft beruht auf etwas, das sich jenseits von Text und äusserlichem Inhalt auffächert und sich allein in der Lust der Betrachtung entfalten kann.
Schönheit finden
Dennoch führen die Bilder auch von sich selbst weg. Ihre Selbstbezüglichkeit kippt und verschränkt sich mit anderen Wirklichkeiten. Die Bilder sind alles andere als gefällig, aber sie bergen die Möglichkeit von Schönheit, indem sie sich für die Einmaligkeit von etwas öffnen, das ist – einer Pflanze, dem Licht. Sie versuchen die Wirklichkeit zu durchdringen, indem sie aus der Sinnlichkeit schöpfen, um in der Gestalt des Kunstwerks zurückzukehren. Die Bilder von Stefan Burger lassen an ästhetische Vorstellungen der traditionellen chinesischen Kunst denken, in der die Schönheit als unergründliches Geheimnis gilt, weil ihre Notwendigkeit nicht auf den ersten Blick evident scheint. Schönheit hat dort aber auch mit der Einmaligkeit des Augenblicks zu tun, sie ist ein Drang und ein Ereignis, das einen ergreifen kann, kein Zustand. Es existiert nicht die statische Vorstellung von Subjekt und Objekt, sondern von Fülle und Leere, von Atem und Rhythmus. Im Dazwischen liegt der künstlerische Ort der „mittleren Leere“, es ist der Raum des Innehaltens, der aber auch zu Verwandlung führen kann.