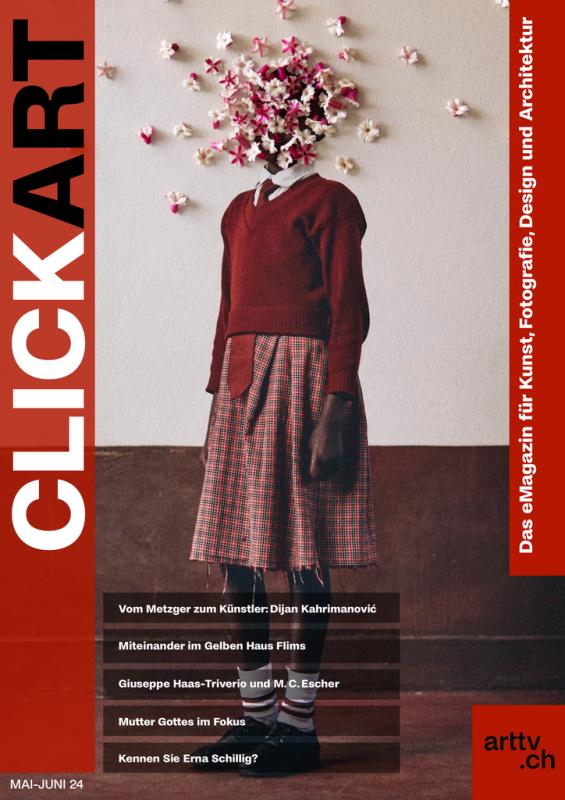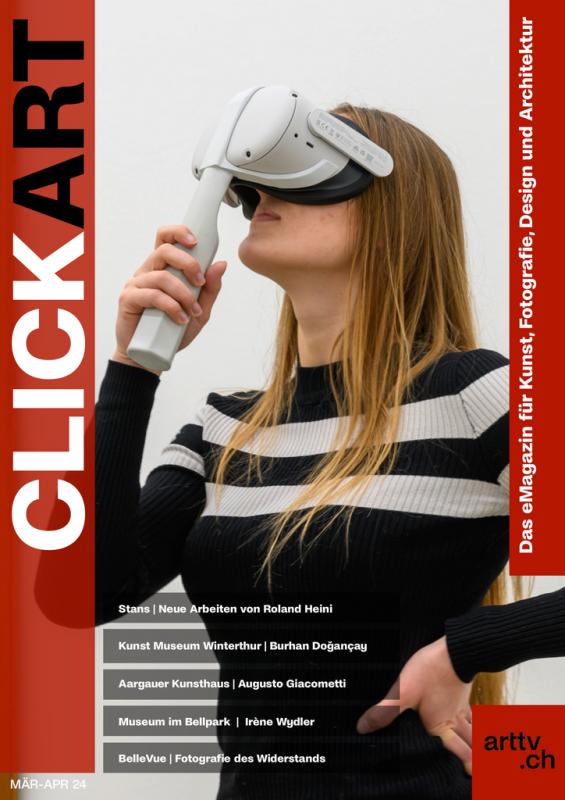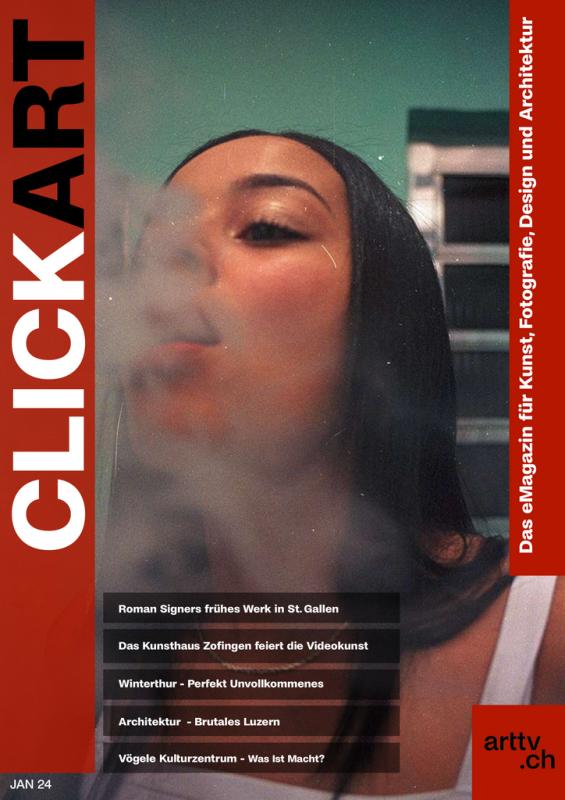Arnold Odermatt
- Publiziert am 12. Mai 2020
Der «unfreiwillige Autodidakt» Arnold Odermatt reflektiert über das gute Bild, Polizeiarbeit und künstlerische Anerkennung für sein Werk.
Er verband Fotografie und Polizeiarbeit zu ein Handwerk. Im Interview zum 95. Geburtstag erzählt der Nidwaldner Polizeifotograf wie er aus der Not (s)eine Tugend machte. Arnold Odermatt erhob seine Dienstpflicht zum ästhetischen Prinzip: Sachlichkeit und die Reduktion auf das Wesentliche, gepaart mit dem Gespür für den richtigen Moment. Seine Arbeiten stiessen international auf grosses Interesse, eher spät spiegelte sich diese Anerkennung in seiner Heimat wieder.
Dieses Interview besteht aus Auszüge aus dem Text «39 Fragen an Arnold Odermatt – Das Gespräch zum 95. Geburtstag». Das Gespräch führte, transkribierte und veröffentlichte Urs Odermatt.
Was ist Fotografie für Sie?
Fotografie war der Ausweg. Bei meinem Eintritt in die Kantonspolizei Nidwalden vor über siebzig Jahren bekam ich die Aufgabe, Autounfälle mit Bleistift, später mit Tusche zu skizzieren. Ich konnte nicht zeichnen und fotografierte die Unfälle vom Standpunkt, an dem die Übersichtskizze entstanden wäre. Gegen den Willen und zum Entsetzen meines Vorgesetzten. Er kannte die Fotografie nicht und war überzeugt, dass Fotos – anders als Bleistiftzeichnungen – Fälschungen Tür und Tor öffneten. […] Später war ich Zeuge, wie ein Richter meinen Vorgesetzten überschwänglich für die Einführung der Fotografie bei Ermittlung und Protokoll lobte. Mein Vorgesetzter verfügte darauf, dass Polizeibeamte Autounfälle künftig nicht mehr skizzierten, sondern fotografierten. Ich war der einzige, der wusste, wie man einen Film in die Kamera legte.
Wie fingen Sie bei der Polizei an?
Mit Fahrrad, Fotokamera, Schreibmaschine und Handschellen aus zweiter Hand. Die Polizei besass damals nichts. Als junger Polizist musste ich mich selbst ausrüsten. Nur eine Uniform in Einheitsgrösse stand zur Verfügung. Straftäter wurden zu Fuss oder auf dem Fahrrad verfolgt. Gut, ausser Wilderei und Verstösse gegen die behördliche Sperrstunde in der Dorfkneipe gab es kaum Verbrechen zu ahnden. Dafür sehr viele Autounfälle, verursacht durch die ganz wenigen Autos im Kanton Nidwalden. Alkohol, kein Tempolimit und kurzluntiges Bauerntemperament waren die Hauptursache. Da Autos damals so stabil waren wie Pappe oder Sperrholz und es keine Sicherheitsgurte gab, war der Blutzoll auch bei Bagatellschäden hoch. Weil die meisten Autounfälle für die Fahrgäste an der Windschutzscheibe endeten. Da endete oft nicht nur die Fahrt.
War es seltsam, als Polizist zu fotografieren?
Seltsam ist, wie wenig seltsam mir mein damaliges Treiben mit der Kamera vorkam. Ich entdeckte schnell, dass die besten Aufnahmen der Autounfälle entstanden, wenn ich von oben fotografierte. Aufsicht brachte Übersicht. Niemand hinderte mich daran, den VW-Bus mitten auf die Autobahn zu stellen, mit Stativ und Kamera aufs Dach zu klettern und die Autobahn für die perfekte Aufnahme eine Stunde lang zu sperren. Notfalls auch die unfallfreie Gegenfahrbahn, wenn das die bessere Perspektive und ein leeres Bild versprach. Niemand hinderte mich daran, mitten in der Nacht am Nachbarhaus zu klingeln, in Socken aufs Bett der Hausherrin zu steigen und die Karambolage vom Schlafzimmer der Dachmansarde aus zu fotografieren. Niemand hinderte mich daran, Baukräne zu entern, in luftiger Höhe den Ausleger hinauszurobben und den alle Fragen beantwortenden Top-Shot des Autounfalls zu fotografieren. Schliesslich trug ich die Dienstuniform der Kantonspolizei Nidwalden.

Hatten Ihre Fotografien einen Einfluss auf die Polizeiarbeit?
Als ich Chef der Verkehrspolizei und Vizekommandant der Kantonspolizei war, hatte der kleine Kanton Nidwalden die Nerven, mich als einzigen Nichtakademiker an die Schweizerische Konferenz der Verkehrspolizeichefs zu delegieren. Als ich als Mann der Praxis in langen Sitzungen zur Sicherheit im Strassenverkehr den akademisch gebildeten Polizeichefs der anderen Kantone schilderte, wie es sich anfühlt, allnächtlich Autounfall-Leichen vom Asphalt zu kratzen und die Schilderungen mit Schwarz-Weiss-Fotos aus Nidwalden dokumentierte, war deren universitäres Wohlbehagen bald so erschüttert, dass sie meinen Forderungen nach strengeren Tempo- und Promillelimits zustimmten.
Wie reagierten die Nidwaldner auf das Fotografieren?
Gar nicht. Es hat niemanden interessiert. Gut, es kann sein, dass ich allen auf den Wecker ging, weil ich mich ausschliesslich für das Fotografieren interessierte. Polizeiarbeit und Fotoarbeit – andere Gesprächsthemen gab es für mich nicht. […] Jetzt ist alles anders. Jetzt sprechen mich hier viele Leute an, die ich nicht einmal vom Sehen kenne, loben mich, laden mich ein, wollen mit mir gesehen werden, machen Dingens – Selfies! –, fragen, warum ich alles mit den Deutschen mache und versichern, schon immer gewusst zu haben, dass diese Fotos einmal berühmt werden. Das Nidwaldner Museum kuratierte eine schöne, grosse Ausstellung und kaufte viele Abzüge in die Kunstsammlung an. Allerdings erst viel später, nachdem ein Zürcher die Leitung des Hauses übernommen hatte.
Wurden die Fotos damals veröffentlicht?
Ja, vor allem in der Lokalpresse, wenn der Autounfall oder das Sommerloch gross genug waren. Meist ohne Budget, da Polizisten ohnehin Staatskosten kosten und – je nach Tagesform des Layouters – im Quer- oder im Hochformat, aber nie im Originalformat der Rolleiflex, quadratisch. Ich fing an, selbst im Labor einen Abzug in Quer- und einen in Hochformat als Vorlage zu vergrössern, auch wenn ich an der Kamera die Aufnahme quadratisch gestaltete. Doch meine Ausschnitte waren für die Lokalpresse eine Art Entwurf; kaum ein Layouter hielt sich daran. Diese Freiheiten konnte ich mir beim Bussgeldbescheid nicht nehmen; die Tarife des Gesetzgebers waren Festpreise.
Sahen Sie sich mehr als Polizist oder als Fotograf?
Ich war immer ein Polizist, der die Aufgabe hatte, den Tatbestand bildlich festzuhalten, als Angehöriger der Verkehrspolizei in der Regel Verkehrsunfälle. Mit dem tauglichsten Werkzeug, das mir zur Verfügung stand: der Fotografie. Ein gutes Bild muss scharf sein und alle Details klar festhalten, vom Vordergrund bis zum Hintergrund, bei jedem Wetter, bei jeder Tages- und Nachtzeit. Ein gutes Bild muss sich streng von allem trennen, was nicht zum Sachverhalt gehört, und es muss einen Kamerastandpunkt haben, der dem Betrachter hilft, zur Sache zu kommen: aufsichtig, symmetrisch, frontal, mit klaren Bezügen statt Perspektiven, die irgendwo im Nirwana landen. Dass aus diesem von mir erwarteten Handwerk eine eigene Handschrift wurde, liegt daran, dass ich nichts wusste, keinen fragen konnte und alles selbst herausfinden musste. Mit dem Druck des Geldbeutels, jeden Fehler nur einmal zu machen. Dass aus der Handschrift später Kunst wurde, dafür kann ich nichts. Es ist das Werk der Zeitläufte – ähnlich wie bei uns in Nidwalden im Leben sture und bockige Zeitgenossen im Nachruf konsequent und gradlinig sind.

Sehen Sie Ihre Arbeit als Dokumentarfotografie?
Das habe ich mir nie überlegt. Ich schoss die Fotos so, wie ich dachte, dass sie gebraucht werden. Die meisten Fotos – vor allem die Karambolagen – zog ich nie im Labor ab, sondern legte sie als Negative ins Archiv. Ausser, der Richter, das Protokoll, eine Versicherung oder die Lokalpresse fragten danach. Dann sollten die Fotos so sein, dass keine Frage offenblieb. Gebrauchsfotografie nach bestem Handwerk. Sachfotografie kommt der Sache näher als Dokumentarfotografie. Entstanden ohne Einfluss und Vorbild, leider, ein unfreiwilliger Autodidakt in Nidwalden.
Als ich im Ruhestand die eine oder andere Kunsthalle besuchte, merkte ich, dass die Arbeit in dieser der Not geschuldeten Selbstbestimmung, die Konzentration auf den eigenen Weg lehrte. So richtete sich mein Blick auf Fotografen, bei denen ich eine retrospektive ‹Augenverwandschaft› sah, Fotografen, die wie ich die Welt in den Fotos entrümpelten (Ist das nicht das Gegenteil von Dokumentarfotografie?) und aufs Wesentliche konzentriert waren – Personen, Sachen, Sachverhalte fotografierten. Etwa Peter Keetman die Sache Volkswagen, Rineke Dijykstra die Sache Pubertät, Michael Kenna die Sache Landschaft. Es gibt bestimmt viele, die ähnlich arbeiten; diese drei blieben in meiner Erinnerung – ich bin Polizist, kein Kunstmensch.
Wählten Sie die Bildsprache bewusst nüchtern?
Ich war Beamter und diente mit den Unfallfotos dem Protokoll und dem Richter. Dekoration störte, lenkte von den Fakten ab. Diese Tatsache war nicht einfach zu akzeptieren im isolierten, eintönigen Nidwalden, das damals nur mit dem Schiff oder über eine Drehbrücke zu erreichen war und wo man genau zwei Menschenrassen kannte: Wir von hier, und die anderen von woanders. Alles, was im Kanton ein bisschen grösser, schöner, schneller oder besser war, war – mangels Vergleichsmöglichkeit – sofort weltgrösstes, weltschönstes, weltschnellstes und weltbestes. Diese gestörte Weltniveauselbsteinschätzung zeigt, wie ähnlich sich geschlossene Gesellschaften sind, egal ob sie sich katholisch oder kommunistisch definieren.
Kam nie der Gedanke, dass Ihre Fotos einen künstlerischen Weg gehen?
Weder mir, noch sonst wem. Kunst waren in Nidwalden die nackten Barockengel in der Pfarrkirche und die schwere Orgelmusik auf der Empore. Kunst gehörte in grosse Gebäude, wie ich sie vom Schweizerischen Landesmuseum vom Hörensagen und vom Kunstmuseum Luzern von aussen kannte. Meine Fotos hatten – wenn die Wertschätzung hoch sein sollte – die Relevanz eines Jodler Chors, einer Jass-Runde oder eines Karneval-Wagens am Fastnachtsumzug. [] Wenn ich auf dem Dach des VW-Busses stand, allein über Rolleiflex und Kamerastativ, war mir klar, dass ich selbstbestimmt das Bild gestaltete. Ich war sicher, wann der Moment für den Auslöser da war und hätte mir an der Kamera von niemandem reinreden lassen.
Gab es Gespräche über Ihre Arbeit als Fotograf?
Nein. An Gespräche über Fotos und deren Entstehen haben in Nidwalden keinen interessiert. […] Es war mir ganz recht, dass ich mit niemandem über die Fotoarbeit reden musste. Was der Bauch weiss, lässt sich schlecht erklären. Aber ein paar persönliche Komplimente über die verschenkten Abzüge hätte ich gerne gehört. Heute ist alles anders – oder auch nicht. Als ich meinen Berliner Galeristen und meinen Sohn an die Eröffnung der Einzelausstellung im Art Institute of Chicago begleitete, veranstaltete der leitende Kurator im Auditorium ein fünfstündiges Symposium mit Vorträgen über meine Fotos. Ich zog die beste Krawatte an und bereiteten ein paar englische Grussworte vor, aber nur einer der Redner erwähnte kurz, der Künstler sei anwesend und begrüsste mich, ohne mich auf die Bühne zu bitten. Mein Sohn flüsterte mir zu, das sei oberste Liga, hier ginge es um mein Werk und nicht um mich, mehr könne ein Künstler im Leben nicht erreichen. Wenn das so ist, gut, schön, noch schöner wäre gewesen, wenn ein Journalist der Nidwaldner Zeitung in Chicago dabei gewesen wäre und berichtet hätte. Wertschätzung in Nidwalden war mir wichtiger als Wertschätzung in der Welt.