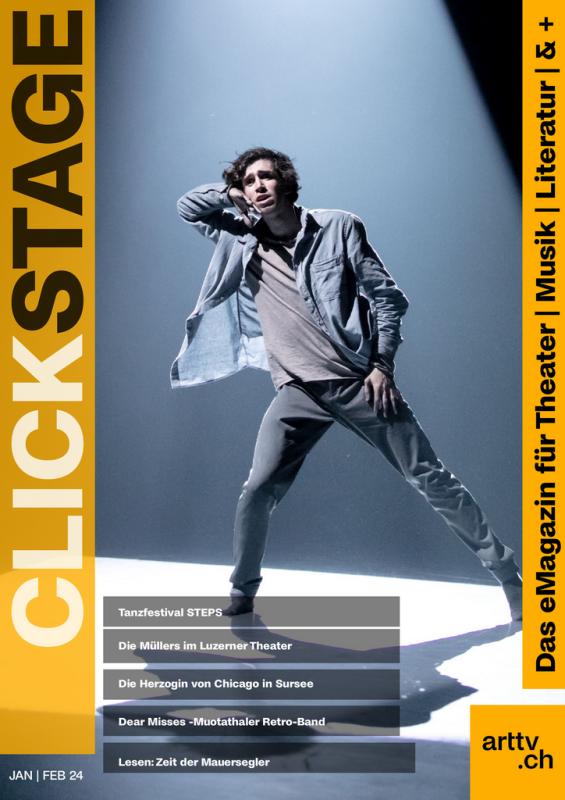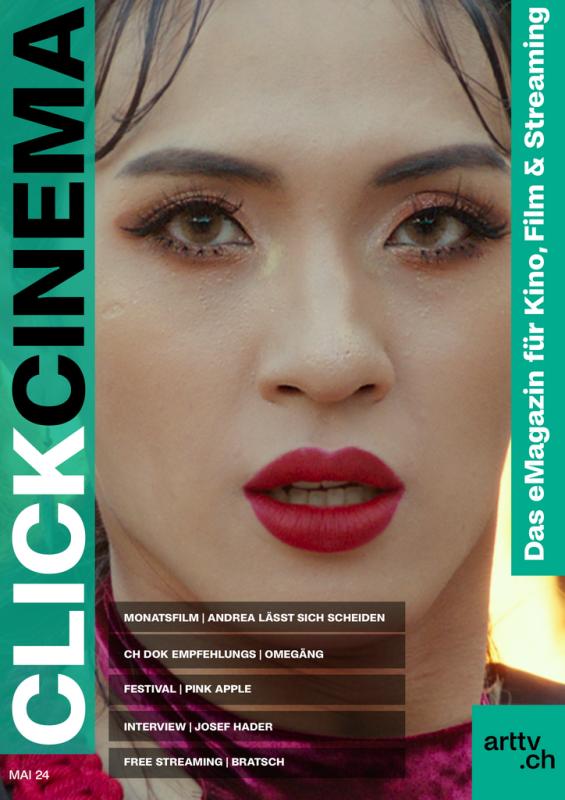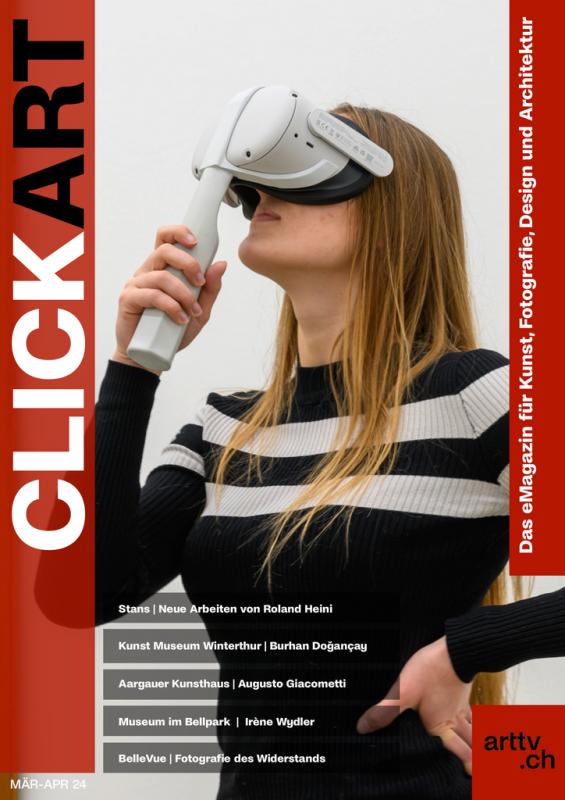Theater St.Gallen | Beast on the moon
Selbst als Waisen aufgewachsen, versuchen zwei Überlebende des armenischen Genozids eine Familie zu gründen. Doch das Erlebte lastet schwer auf ihren Schultern, die Vergangenheit holt sie immer wieder ein.
Beast on the moon
Amerika in den 20er-Jahren. Ein junges Migrantenpaar aus Armenien baut sich eine neue Existenz auf. Beide haben den armenischen Genozid zwar überlebt, dabei aber ihre Eltern verloren. Ihr Leben ist von diesem Ereignis überschattet. «Sie können das Geschehene nicht vergessen, gleichzeitig wollen sie ein neues Leben aufbauen», beschreibt Regisseur Artak Grigorjan das Hauptthema des preisgekrönten Stücks «Beast on the moon» von US-Autor Richard Kalinoski. Der Genozid an den Armeniern stellt zwar ein wichtiges Element des Stücks dar. Doch er strebe keine historische Rückschau an, betont Grigorjan. Es sei zwar wichtig, bestimmte Ereignisse nicht zu vergessen, denn «sonst wiederholen sie sich leicht». Doch letzten Endes gehe es in «Beast on the moon» um die zeitlose Frage, wie Menschen nach Katastrophen ihr Leben wieder aufbauen, und wie sie diese verarbeiten. Grigorjans besonderes Anliegen ist das Schicksal der Waisenkinder, die jede Katastrophe zurücklässt. «Über sie spricht man seltener als über die Todesopfer.»
Claudine Gaibrois.
Ein Stück Schweizer Geschichte
Bemerkenswert war das Ausmass der schweizerischen Reaktion, die ausschliesslich auf Nichtregierungsebene stattfand: eine zivile Schweiz scharte sich um das Thema Armenien, eine Bewegung ging von protestantischen Kreisen der französischen Schweiz aus, durchdrang die verschiedensten Gruppen und Schichten der Bevölkerung, von den Protestanten bis zu den Juden, von den Katholiken bis zu den Freimaurern, von den Sozialisten bis zum gehobenen Bürgertum. Diese Bewegung organisierte unzählige Versammlungen und brachte in einem halben Jahr fast eine halbe Million Unterschriften zusammen, um ihre Solidarität mit den Leidenden kundzutun und den Bundesrat – erfolglos – zu einer Intervention zu bewegen.
Bewegung für die Armenier
Das Selbstverständnis der schweizerischen Bewegung für die Armenier war dasjenige einer christlich geprägten, breiten zivilen demokratischen Gesellschaft, die mittels friedlicher Kundgebungen und Aktionen in der nationalen und internationalen Politik etwas bewirken wollte. Die damaligen Veranstaltungen inklusive der Petition an den Bundesrat hatten zwar keine direkte Auswirkung auf die internationale Politik. Aber sie erbrachten eine substantielle materielle Hilfe für die Notleidenden und eine moralische Unterstützung für das armenische Volk. Sie legten das Fundament für ein langfristiges Engagement der nichtoffiziellen Schweiz für Armenien. Die von der menschlichen Not aufgerüttelte, von «Armenien» betroffene zivile Schweiz der Jahrhundertwende sah sich herausgefordert, etwas vom Besten, was sie selber hatte oder zu haben glaubte, in jene ferne Gegend, zu jenem bedrohten christlichen «Bergvolk» zu bringen, mit dem sie sich identifizierte.