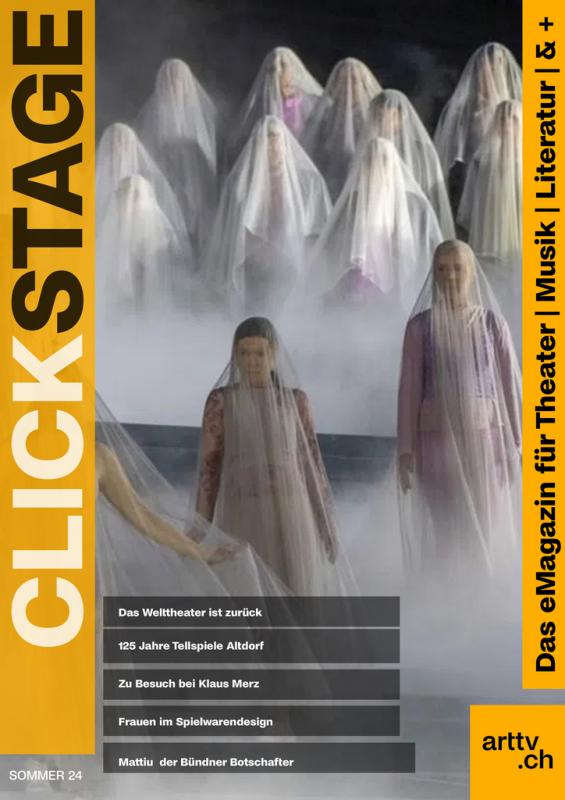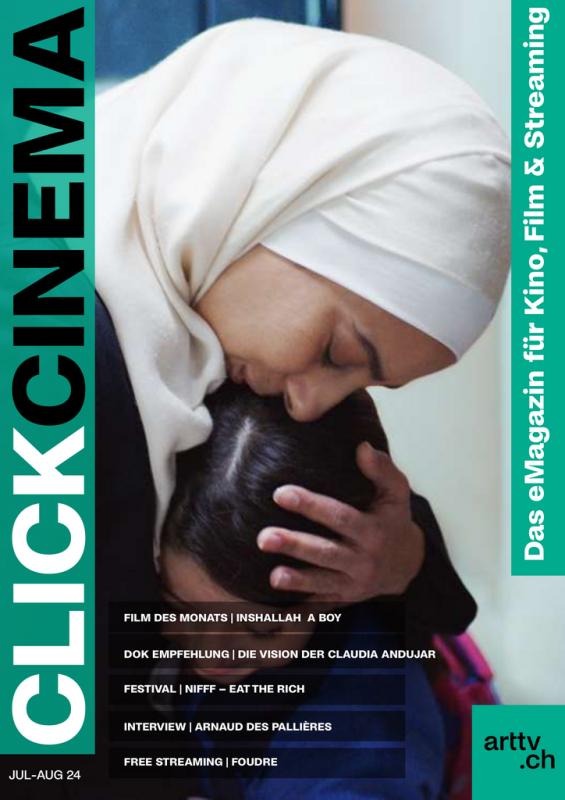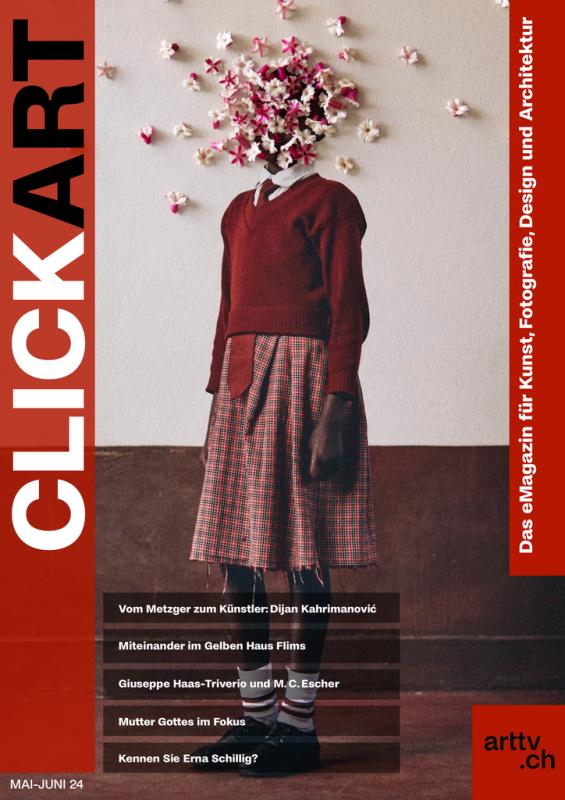Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Eine Ausstellung im Naturmuseum Thurgau beantwortet Fragen rund um das domestizierte Vogeltier
Ob Frühstücksei oder Pouletbrust: Das Huhn liefert Nahrungsmittel und ist eines unserer wichtigsten Nutztiere. Aber woher stammt es eigentlich?
Ist das Huhn wirklich dumm und blind? Wie viele Hühnerrassen gibt es und wie wurde das Haushuhn zum derart gewichtigen Nahrungsmittellieferanten? Und was bedeutet das für das – oft nur kurze – Leben der Tiere? Die Sonderausstellung «Hühner – unterschätztes Federvieh», produziert vom Museum zu Allerheiligen Schaffhausen, blickt über den Tellerrand hinaus. Sie ermöglicht es, die vielfältigen Facetten des Huhns zu entdecken und kritisch über seine Nutzung nachzudenken.
Fun Facts
Lange bevor es Hühner gab, gab es Eier legende Tiere – beispielsweise Dinosaurier, die als direkte Vorfahren der Vögel gelten. Aus biologischer Sicht ist die Frage nach dem Huhn und dem Ei also leicht zu beantworten. Wenn es um die Entstehung des Lebens allgemein geht, wird es komplexer. Nach der heute plausibelsten Theorie bildete sich das erste Leben in der Tiefsee vor rund 3,5 Milliarden Jahren. Das Ei ist im Laufe einer langen evolutiven Entwicklung aus diesen Ursprungsformen des Lebens entstanden. Das Ei ist ein Wunder der Natur!
Ob ein Ei weiss oder braun ist, wird durch das Erbgut der Elterntiere bestimmt. Die Vorlieben der Konsumentinnen entscheiden, welche Eierfarbe häufiger produziert wird. In der Schweiz sind es heute zu rund zwei Dritteln weisse.
Das Huhn gilt sprichwörtlich als dumm. Forschungsergebnisse belegen jedoch das Gegenteil: Hühner verfügen über ausgeprägte kognitiven Fähigkeiten. Hühner erinnern sich an Objekte, auch wenn sie diese nicht mehr sehen. Sie können zählen oder haben zumindest eine Vorstellung von «mehr» und «weniger»: In einem Experiment verteilten Forscher hinter einem Sichtschutz rechts drei Bälle, links fünf. Die Hühner wählten die grössere Anzahl. Die Forscher legten dann die drei Bälle von rechts nach links. Wiederum wählten die Hühner die grössere Anzahl. Das Gehirn eines Huhns ist rund zehnmal grösser als das eines Reptils gleicher Grösse – und es ist gescheiter als wir meinen.
Das Huhn kennenlernen im Naturmuseum Thurgau
In unserem Alltag ist das Huhn als Eier- und Fleischlieferant kaum mehr wegzudenken: Schweizer Legehennen legen jährlich rund eine Milliarde Eier. Pro Kopf und Jahr konsumieren wir in der Schweiz durchschnittlich fast 200 Eier und 15 Kilogramm Pouletfleisch. Kein Wunder ist das Haushuhn heute eines unserer wichtigsten Nutztiere. In Europa übertrifft sein Bestand denjenigen aller Wildvögel zusammen. Die Karriere des Huhns ist also beispiellos. Im Vergleich mit anderen Nutz- und Haustieren wie Hund, Schaf oder Katze wurde es spät domestiziert. Im Lauf der Jahrhunderte wurden unzählige, zum Teil ausgefallene Hühnerrassen gezüchtet. Im Verhalten des Huhns, auch der modernen Hochleistungshühner, zeigen sich bis heute Eigenarten seiner wilden Vorfahren. Ornithologen unterscheiden heute weltweit etwa 300 Wildhühnerarten. Hühnervögel leben auf allen Kontinenten, mit Ausnahme der Antarktis. Acht Arten sind auch in der Schweiz heimisch. Typisch für Hühnervögel sind ein
massiger Körper und kurze Flügel. Die meisten Arten fliegen nur selten und sind bodenlebend. Oft tragen die Männchen ein auffallend buntes Gefieder und farbige Hautlappen, während die Weibchen unauffälliger erscheinen. Neben dem Haushuhn werden weitere Hühner als Nutzgeflügel gezüchtet. Andere sind beliebt als Ziergeflügel oder Jagdbeute.
Vom Urwald in den Hühnerstall
Das Haushuhn hat seine Wurzeln im asiatischen Urwald. Bis heute ist sein genauer Ursprung umstritten und Gegenstand der Forschung. Neuste Untersuchungen legen nahe, dass das Huhn vor rund 3 500 Jahren domestiziert wurde – weit weniger früh, als bisher angenommen. Als Urahnen des Haushuhns werden heute mindestens zwei Wildhühnerarten aus den tropischen Wäldern Asiens angesehen. Seit langem unbestritten als Stammform ist das Bankivahuhn, das in weiten Teilen Asiens beheimatet ist. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass mit dem indischen Sonnerathuhn eine zweite Art irgendwo am Beginn der Domestikation des Huhns gestanden hat. Durch Züchtung entstanden im Lauf der Zeit weltweit unzählige Hühnerrassen. Sie unterscheiden sich in Aussehen und Grösse, aber auch in Legeleistung, Fleischansatz und der Bereitschaft zu Brüten. Die Vielfalt dieser traditionellen Rassen ermöglichte in der Folge die Züchtung der modernen Hochleistungshühner.
Aus dem Leben eines Huhns
Obwohl seit mehreren Tausend Jahren vom Mensch durch Züchtung verändert, zeigt das Haushuhn in seiner Lebensweise noch heute viele Eigenarten ihrer wilden Vorfahren. Voraussetzung dafür ist eine artgerechte Haltung, die dem Wesen des Tiers Rechnung trägt. Hühner leben sozial in Gruppen und kommunizieren auf komplexe Weise miteinander. Unter den Hennen herrscht die sprichwörtliche Hackordnung. Alle kennen die Rangfolge untereinander, doch wird sie immer wieder aufs Neue unter Einsatz von Schnabelhieben verhandelt werden. Ein Hahn steht ganz zuoberst in der Rangordnung der Gruppe. Er paart sich als einziger Hahn regelmässig mit den Hennen, beschützt sie vor Feinden, schlichtet bei Streit, zeigt die guten Futter- und Schlafplätze. Die rangniederen Hähne halten Abstand, warten aber auf einen günstigen Augenblick, um den dominanten Hahn herabzustufen. Hühner sind Allesfresser und suchen am Boden nach vielseitiger Nahrung. Geschlafen wird an einem sicheren Platz in der Höhe. Ihr Federkleid pflegen sie mit Staubbädern. Die Jungen schlüpfen nach 21 Tagen aus den Eiern.
Hühnerland Schweiz
In den letzten 70 Jahren wurden aus dem Hofhuhn auf Höchstleistung getrimmte Lege- und Masthühner gezüchtet. Kein anderes Nutztier hat sich so rasant und radikal verändert. Heute sind Hühner eine Massenware und eine der beliebtesten Proteinquellen in unserer Ernährung. Ihre wirtschaftliche Bedeutung ist enorm. Für die Hühnerhaltung gelten in der Schweiz im internationalen Vergleich eher strenge Vorschriften. Doch ist das Geschäft mit den Hühnern ein globales – angefangen bei der Herkunft der Hühner selbst, über ihr Futter bis zum Konsum von Eiern und Pouletfleisch. Die Schweiz war Vorreiterin, als 1992 das Verbot für Käfighaltung von Legehennen in Kraft trat. Heute haben wir als Konsumenten beim Kauf von Schweizer Eiern die Wahl aus drei Haltungsformen: Boden-, Freiland- oder Biohaltung. 2021 lebten zwei Drittel der 3.5 Millionen Legehennen in der Schweiz in Freilandhaltung. Der Bioanteil beträgt aktuell rund 20 Prozent – in den letzten 10 Jahren hat er sich etwa verdoppelt. Rund zwei Drittel des in der Schweiz gegessenen Pouletfleischs stammte 2021 aus Schweizer Produktion. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren stetig gestiegen – vor 5 Jahren war es erst etwas mehr als die Hälfte. Fast die Hälfte des importierten Hühnerfleisches kam gefroren aus Brasilien, die andere Hälfte grösstenteils aus europäischen Ländern. Die negativen Umweltauswirkungen der Geflügelproduktion sind im Ausland überwiegend grösser als bei einem Schweizer Poulet. Während in Brasilien beispielsweise für den Mais- und Soja-Anbau Regenwald abgeholzt wird, stammt das Soja für Schweizer Hühner aus Europa. Der Bestand der Nutzhühner in der Schweiz erreichte 2021 eine Rekordmarke von knapp 15 Millionen Tieren. In den letzten 20 Jahren hat sich Ihre Anzahl fast verdoppelt. Gegen zwei Drittel der Nutzhühner in der Schweiz sind Mastpoulets. Bei diesen wurde in den vergangenen Jahren auch der grösste Bestandszuwachs verzeichnet.
(Text: Naturmuseum Thurgau Frauenfeld)