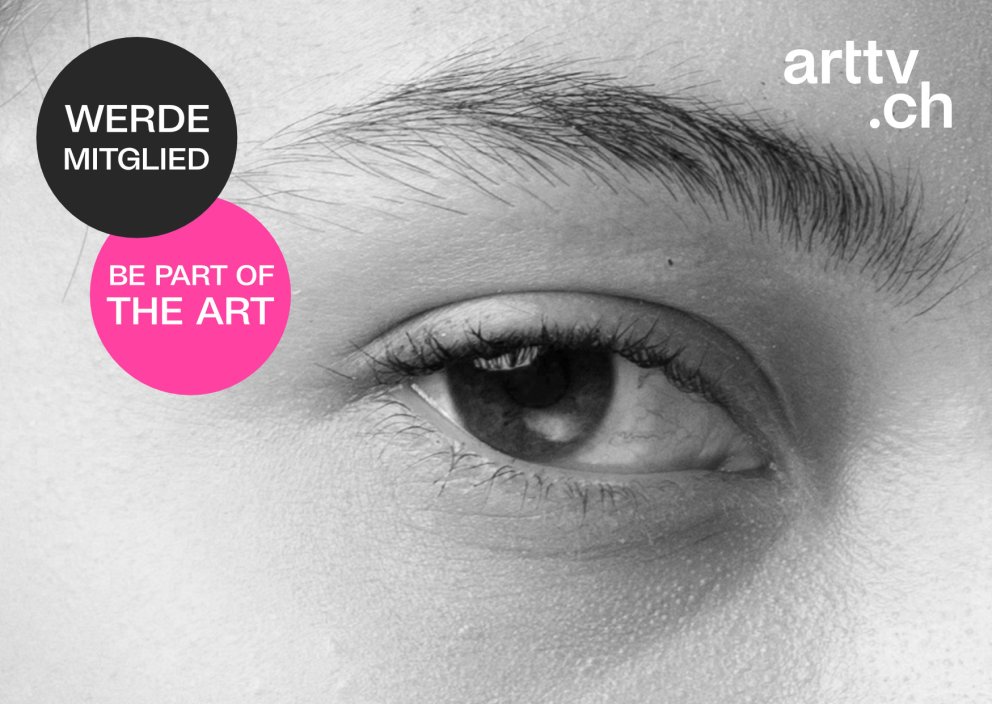Meinrad Burch-Korrodi machte sich vor allem als konsequenter Neuerer in der sakralen Kunst international einen Namen und nahm erfolgreich an nationalen und internationalen Ausstellungen teil. Er verwendete konsequent die strenge Formsprache des Bauhauses und brach damit mit der im frühen 20. Jahrhundert üblichen barocken Auffassung, wie Schmuckstücke und sakrale Geräte auszusehen haben.
Das Porträt eines Obwaldner Visionärs
Mit grossen Ideen und klaren Formen brachte der Obwaldner Goldschmied, Unternehmer und Sammler sakrale Kunst und Bauhaus-Einflüsse zusammen.
Meinrad Burch-Korrodi (1897–1978) absolvierte eine Goldschmiedelehre in Luzern und verbracht weitere Ausbildungs- und Studienjahre in London, Paris und New York. 1925 gründete er ein eigenes Goldschmiedeatelier in Luzern, das er 1932 nach Zürich verlegte. Den Hauptteil seines kunsthandwerklichen Schaffens widmete er der Sakralkunst. Seine Kelche, Ziborien, Monstranzen, Reliquienbehälter, Kruzifixe, Kerzenstöcke und Tabernakel schuf er in pionierhaft modernen Proportionen und Linienführungen. Er nahm erfolgreich an nationalen und internationalen Ausstellungen teil. Ab 1951 war er Träger des Ehrenrings der Internationalen Gesellschaft für Goldschmiedekunst, 1977 wurde ihm der Obwaldner Kulturpreis verliehen. Meinrad Burch-Korrodi legte eine bedeutende innerschweizerische Grafiksammlung an.
Eine neue Formsprache
Um 1925 gab es einen kleinen Kreis von jungen Goldschmieden, die sich für eine formale Erneuerung ihrer Arbeit einsetzten und Arbeiten anboten, handwerkliche Einzelstücke, die ein neues, kühles Formempfinden verband. Zu dieser jungen Vorhut gehörte auch Meinrad Burch-Korrodi. Als Erneuerer für die Innerschweiz galt u. a. auch der Luzerner Arnold Stockmann. Im Gegensatz zu Stockmann distanzierte sich Burch schon bald von den historisierenden Stilanleihen, welche noch seinen liturgischen Geräte der 1920er-Jahre geprägt hatten. Er gab den kirchlichen Objekten neue Impulse hinsichtlich einer Erneuerung und Vereinheitlichung der Form. Meinrad Burch-Korrodis Arbeiten entstanden zwischen dekorativer Eleganz, kunsthandwerklichem Interesse und kühler Sachlichkeit sowie in einer Wechselbeziehung zwischen Funktion und Form. Es wurde Burch-Korrodis Lebensaufgabe, eine neue Formensprache zu generieren. Aus einfachsten geometrischen Grundformen heraus – wie Kreis, Oval, Kugel, Zylinder – entwickelten Burch und seine Mitarbeiter ihre Geräte. Zunehmend schwanden dekorative Elemente.
Der Unternehmer Burch-Korrodi
In der Werkstatt Burch-Korrodi waren während der Jahre zwischen sechs und zwanzig Mitarbeiter angestellt. Burch-Korrodis kaufmännisches Talent ermöglichte eine ideale Besetzung der verschiedenen Aufgaben in der Werkstatt. Er wusste genau, welches Talent er wo einzusetzen hatte, um den grösstmöglichen Erfolg zu erlangen. So war es v. a. Burch-Korrodis Aufgabe, im Geschäft die Fäden zusammenzuhalten und Aufträge einzuholen, was ihm dank seines guten Beziehungsnetzes bestens gelang. Die hohe Qualität der Entwürfe und das fachgemässe Bearbeiten der Materialien ist aber vorwiegend den Mitarbeitern der Werkstatt Burch-Korrodi zu verdanken. Vier der Mitarbeiter spielten eine besonders grosse Rolle: Heinrich Baumann (1933–1942) und Kurt Aepli (1942–1967) waren nicht nur an der handwerklichen Ausführung, sondern auch an der künstlerischen Formung beteiligt. Als dritte Person ist Martin Bucher zu nennen, der nicht nur seine Lehre in der Werkstatt absolvierte, sondern der Firma bis zum Schluss erhalten blieb. Schliesslich ist auch der norwegische Emailleur Berger Bergersen zu nennen, der während der letzten Werkstattjahre zum Erfolg der emaillierten Geräte und Objekte Grosses beigetragen hatte. Auch wenn die Formgebung und Ausführung an Meinrad Burch-Korrodis Vorstellungen und Ideale gebunden war, liess er seinen Mitarbeitern mit ihren vielseitigen Talenten und Fähigkeiten bei ihrer Arbeitsgestaltung äusserste Freiheit. Ohne den Einsatz der vielen Mitarbeiter wäre dieses Lebenswerk undenkbar gewesen.
Technik und Material
Die Technik und die Möglichkeiten des Materials waren grundlegende Elemente einer Arbeit und bildeten die Basis für eine Formgebung. Die beiden Materialien Draht und Blech bildeten die Basis des Aufbaus aller Schmuckstücke und jedes liturgischen oder profanen Werks. Neben klassischen Gestaltungsmaterialien, wie verschiedene Edelmetallen und Edelsteinen, setzte die Werkstatt von Burch-Korrodi auch andere Werkstoffe ein, um andere, weniger gewöhnliche Kontrastwirkungen zu erzeugen. So führte Burch-Korrodi die Verwendung von Bergkristallen in seinem Werk weiter und entwickelte sie in die Richtung seiner Auffassung der klaren Form. Weiter wurde in der Werkstatt versucht, die Oberflächen der Edelmetalle mit Farbe zu kontrastieren. Später wurde zum selben Zweck Emaille als Gestaltungsmittel eingesetzt. Zuerst nur um wenige Stellen eines Objekts zu akzentuieren, und dann zunehmend um ganze Flächen zu gestalten. Diese grossflächigen Emaillierungen und kompletten Überemaillierungen auf liturgischen Geräten aus seiner Werkstatt sind die ersten überhaupt bekannten.
(Textgrundlage: Historisches Lexikon der Schweiz, Sammlung Meinrad Burch-Korrodi)