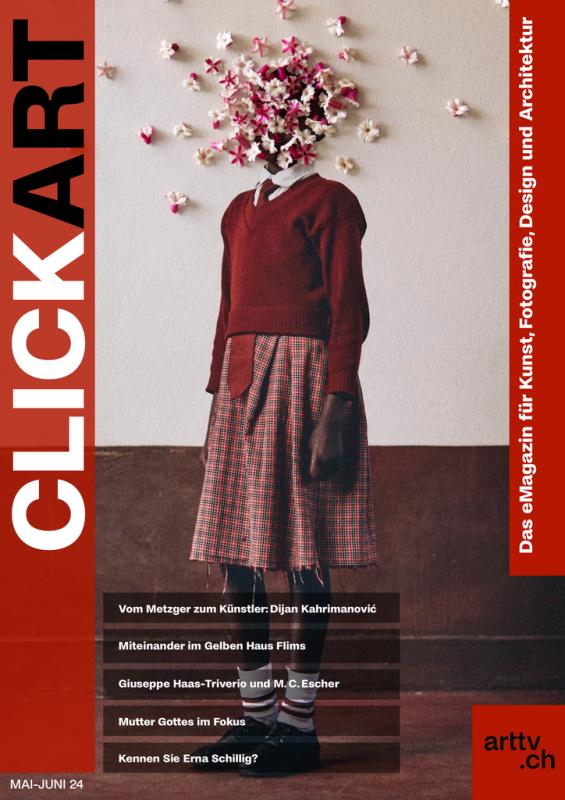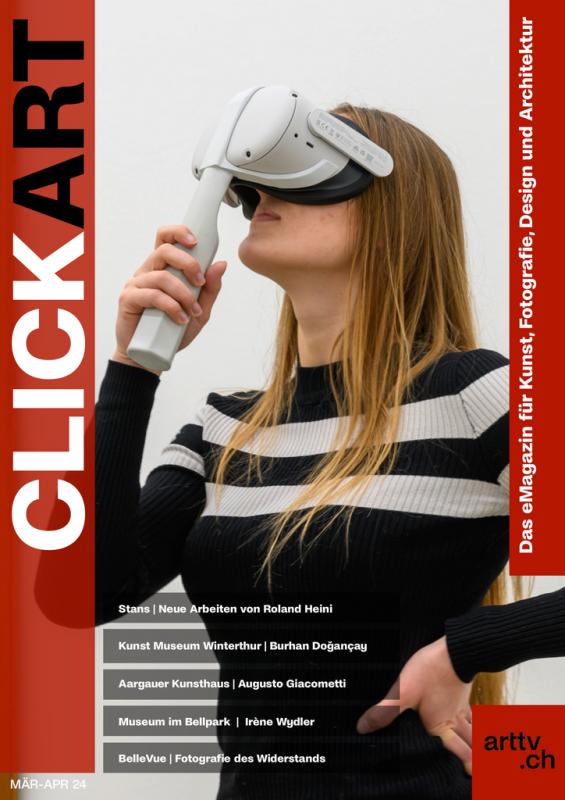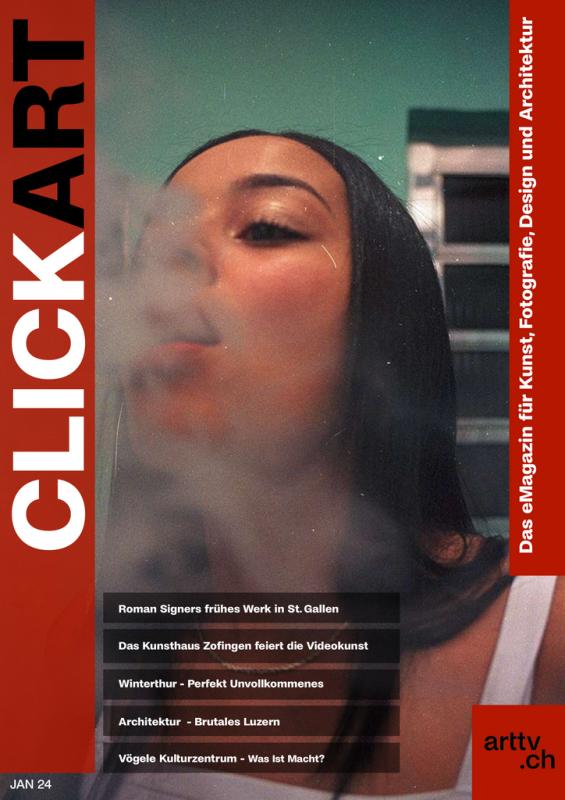The Eternal Flame | Kunsthaus Baselland
„Ewigkeit“ ist eines dieser Wörter, die wir verwenden, ohne dafür ein bestimmtes Konzept zu haben. Als existentielle Erfahrung der Lebenszeit und als metaphysische Idee es „Überzeitlichen“ ist die Frage nach unserer Beziehung zur Zeit längst ein philosophischer Klassiker. So diskutierten schon die griechischen Philosophen Platon und Aristoteles das grosse Rätsel von der Entstehung der Welt immer in Bezug auf eine ewige Existenz von Materie.
Man glaubte nicht daran, dass die Welt, wie der Mensch sie kennt, quasi aus dem Nichts heraus entstehen konnte. Auch der Theologe und Philosoph Augustinus betrachtete an der Schwelle zwischen Antike und Mittelalter die Ewigkeit als immer währende Kraft und bezeichnete sie sogar als Negation aller Zeit. Während in den nachfolgenden Jahrhunderten der Ewigkeitsbegriff unter Theologen und Philosophen immer wieder als Hoffnung auf einen Gott verstanden wurde, kümmerten sich Henri Bergson im 19. Jahrhundert und Martin Heidegger im 20. Jahrhundert eher um die modernen Schwierigkeiten mit der Ewigkeit. Bergson stösst dort vor allem auf das prekäre Defizit der Sprache, Ewigkeit zu fassen, geschweige denn, sie überhaupt zu beschreiben. Heidegger versuchte hingegen, das Ewige z.B. in der Kunst anzusiedeln – um das Unvorstellbare denkbar zu machen. An diesem Berührungspunkt zwischen Sprache und ästhetischer Erfahrung von Kunst lässt sich auch über Ewigkeit nachdenken.
Wo sich die räumlich-zeitliche Orientierung aufzulösen scheint, beginnt das Nachdenken über Unendlichkeit. Obwohl unendliche Dimensionen kaum vorstellbar sind, sind sie trotzdem individuell erfahrbar. Dieses Paradox bildet den Ausgangspunkt des Ausstellungskonzeptes und findet seinen Widerhall in künstlerischen Positionen der Gegenwart, welche sich zwischen abstrakter Bildgrammatik und Landschaftsmotiven bewegen – zwei der wichtigsten Bildsprachen der Moderne, die ein Nachdenken über die Unendlichkeit möglich machen.