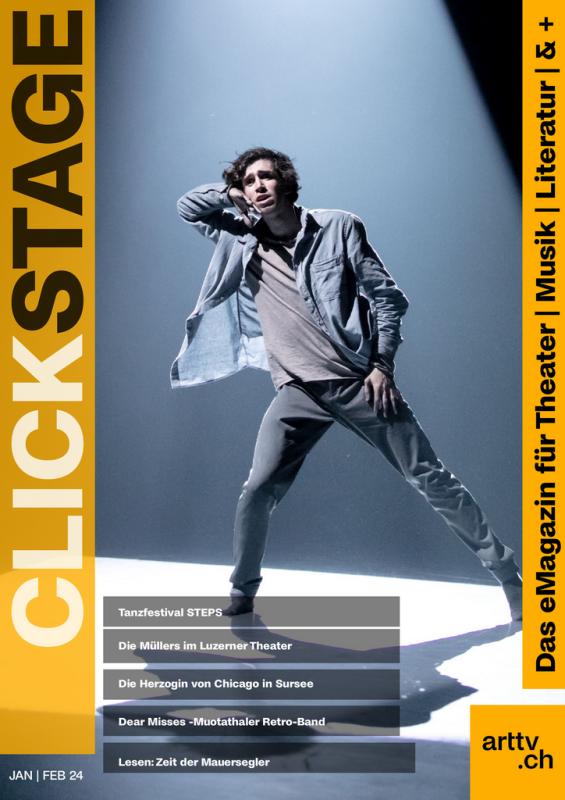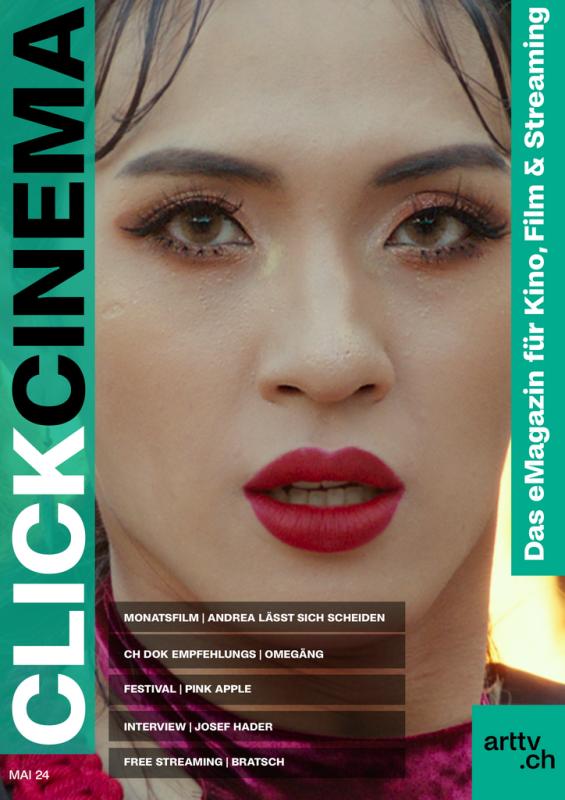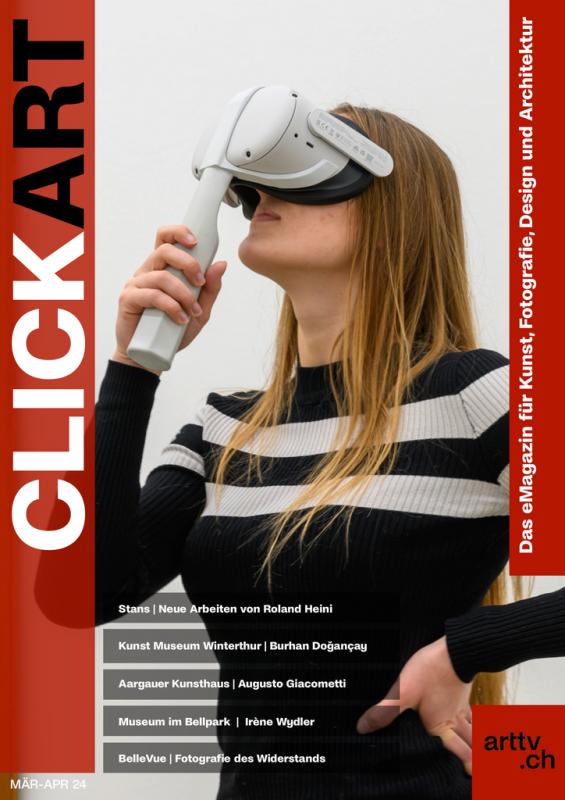Theaterwerkstatt Gleis 5 | Der Held der westlichen Welt
Das Ensemble erzählt eine Geschichte über den Umgang mit dem Fremden - musikalisch untermalt mit irischem Folk.
Vor elf Tagen hat ein junger Mann seinem tyrannischen Vater mit einem Spaten den Schädel gespalten und ist seitdem auf der Flucht. Statt Ablehnung erfährt der Täter an seinem Fluchtort Bewunderung. John Millington Synges Komödie scheint auch 111 Jahre nach der Uraufführung unserem Umgang mit dem Fremden zu bestätigen: Nur wenn das Fremde überhöht wird, ihm magische Eigenschaften zugeschrieben werden, kann es auf übertriebene Weise sowohl bewundert als auch gefürchtet werden.
Eine irische Geschichte
Ein junger Mann taucht spätabends in einer Spelunke irgendwo in der irischen Pampa auf. Er wirkt gehetzt, und spätestens nachdem er die Anwesenden gefragt hat, ob sich denn die Polizei an diesen Ort verirrt, zieht er alle Aufmerksamkeit auf sich. Von den neugierigen Dorfbewohnern bedrängt, rückt er mit seiner blutigen Geschichte heraus: Vor elf Tagen hat er seinem tyrannischen Vater mit einem Spaten den Schädel gespalten und ist seitdem auf der Flucht. Erstaunlicherweise ist die Reaktion der Zuhörenden keineswegs verängstigt, vielmehr macht sich Bewunderung für die Tat des jungen Mannes breit, ja, sie wird sogar zur Heldentat erklärt. Der Autor erzählt eine Geschichte über den Umgang mit dem Fremden, der sich auch 111 Jahre nach der Uraufführung nicht wesentlich verändert zu haben scheint.
Hinterfragen des Heldetums
Christopher Mahon ist kein Held und hat zu Beginn der Geschichte auch keinerlei Absichten, sich als solchen darzustellen. Es ist die Dorfgemeinschaft, die ihn dazu macht. Das heisst, dass das Heldentum gar nicht soviel mit Individualität zu tun hat, wie man im ersten Moment denkt, denn was ein Held sein soll, wird durch das gesellschaftliche Koordinatensystem, die moralischen Werte einer Gemeinschaft bestimmt. Im politisch unruhigen Irland des beginnenden 20. Jahrhunderts sind das Mut, Gerechtigkeitssinn und das damit einhergehende Aufbegehren gegen Unterdrückung – ironischerweise Werte, die im Alltag der Dorfbewohner keine grosse Rolle zu spielen scheinen -, bildet dort doch vor allem ein kleingeistiger Katholizismus, das Streben nach Reichtum und der Alkoholrausch die moralische Basis für gesellschaftliches Handeln. Somit verweist die Heldenkürung Christopher Mahons auf das eklatante Auseinanderklaffen von moralischem Anspruch und politischer Wirklichkeit und entlarvt damit eine heuchlerische Gesellschaft. Diese Diskrepanz ist bis heute täglich gelebte Realität. Zuhause wird der Kanon der sogenannten westlichen Werte zitiert, ausserhalb der Grenzen werden diese mit Füssen getreten.