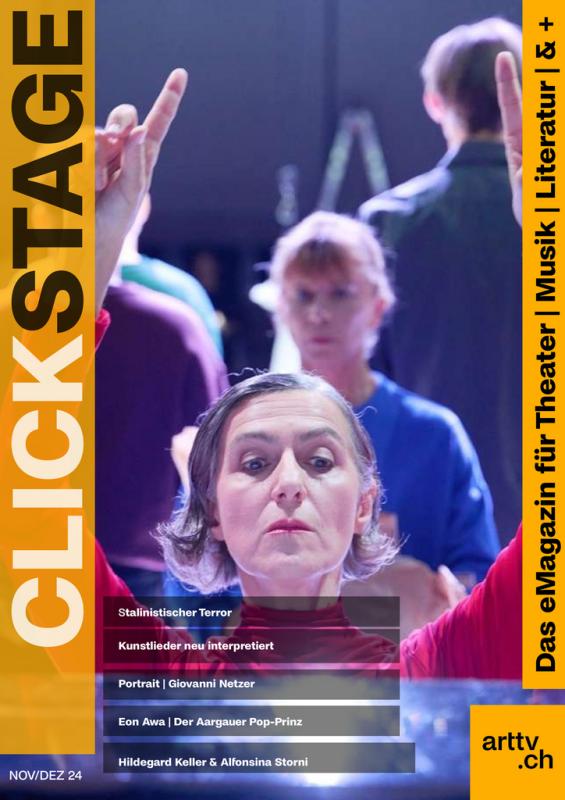Matti Salminen als überragender Boris in einer unschlüssigen Inszenierung
Opernhaus Zürich | Boris Godunow
- Publiziert am 28. April 2008
Kritik:
Wann immer eine Bühne BORIS GODUNOW auf den Spielplan setzt, muss sie sich für eine der Versionen entscheiden. In Zürich spielt man nun den so genannten Original-Boris von 1872, allerdings ohne das Schlussbild im Wald von Kromy. Die Oper geht nun mit dem Tod des Titelhelden zu Ende. Diesen Strich hat Mussorgskij zwar in mehr oder weniger starker geistiger Umnachtung einmal ausdrücklich zugelassen, doch schmerzt er. Denn in diesem Revolutionsbild offenbart sich u.a. gerade die Originalität und das Neuartige an diesem Volksdrama. Mit dem Weglassen dieses Bildes hat man am Zürcher Opernhaus eine Chance vertan, es hätte Aufschlüsse geben können, die die Inszenierung im Verlauf des Abends nicht hervorbrachte (Regie: Klaus Michael Grüber, krankheitsbedingt konnte er nur einen Teil der Regiearbeiten übernehmen / Ellen Hammer; Bühne: Eduardo Arroyo, Kostüme: Rudy Sabounghi).
So blieb die szenische Umsetzung seltsam unentschieden. Da ist einerseits der Hauptakteur des Dramas, der Chor: Modern gekleidet, mit Turnschuhen, Plastiktüten, Einkaufs- und Kinderwagen. Andererseits die Welt der Potentaten: Starr im Goldpanzer gekleidet (Boris), üppig in Silber und Zobel (Schuiskij), elegant in Abendroben (die fürstliche Gesellschaft in Polen), in traditioneller Tracht (Schankwirtin) und ärmlichen Mönchskutten (Pimen). Das Schachbrett, auf welchem sich das Volk und die Protagonisten der ersten fünf Bilder bewegen, hätte vielerlei Möglichkeiten zu einer vertieften Personenführung geboten – allein sie findet nicht statt. Rampengesang, kaum vorhandene Interaktionen und statische Choreographie des Chores prägen diese Szenen. Wenige Versatzstücke stehen verloren auf der Bühne herum, so im ersten Akt eine putzige Klosterzelle, die an den Stall von Bethlehem erinnert, davor liegt ein ausgestopfter Löwe. Überhaupt scheinen die Tierfiguren das Interesse des Inszenierungsteams geweckt zu haben. Im Polenakt darf sich der falsche Dimitrij auf ein überdimensioniertes Karussellpferd setzen und so von seinem Marsch auf Moskau träumen, die polnischen Adligen führen ein Lamm zur Opferbank, vor der Basiliuskathedrale taucht eine riesige Schmeissfliege hinter dem Gottesnarr auf. Sie soll wohl die Gewissensbisse des Boris symbolisieren, welche er nicht mehr verscheuchen kann. Auch das Lied der Amme von der Mücke und der Libelle wird selbstverständlich von Fjodor mit Tierfiguren nachgespielt. Und während die Schankwirtin das Lied vom Enterich singt, ergötzt sich das Auge an allerlei Federvieh in Käfigen. Niedlich … aber mehr nicht!
Die gestylte Dornenkrone im Polenakt hätte wohl besser zum hungernden und leidenden Volk vor der Basiliuskathedrale gepasst. Doch dort wird die geplagte Menge von einer Art Luftschiff bei Laune gehalten. Spiele statt Brot?
Zum Glück trösten die Musik und vor allem die Stimmen über manches szenische Ärgernis hinweg. Allen voran ist selbstverständlich Matti Salminen zu nennen, der in Zürich bereits seinen dritten BORIS singt (1984 Götz Friedrich / Ralf Weikert, im Hallenstadion, 1999 David Pountney/Franz Welser-Möst mit dem Ur-Boris). Seiner unglaublichen Bühnenpräsenz und der wunderbar – auch im zartesten Piano – strömenden, voluminösen Bassstimme ist es zu verdanken, dass den Zuhörern das Leiden dieses Potentaten nahe geht. Auf ähnlich hohem Niveau bewegen sich die beiden anderen grossen Bässe, Pavel Daniluk als wunderschön phrasierender Pimen (kündigt sich hier der nächste Interpret des Boris an?) und Andreas Hörl als fantastisch singender und agierender Warlaam. Der Polenakt steht ganz im Banne des Rollendebüts von Luciana d’Intino, welche man hier bisher vor allem als Eboli und Azucena kennen und lieben gelernt hat. Ihre Marina, mit kernig – kräftigem, auch mal ordinär und guttural klingendem Mezzo gesungen, vermag alle Regungen dieser Frau aufs Wunderbarste auszudrücken: Von Ehrgeiz getrieben, vom Jesuiten missbraucht und den falschen Dimitij liebend. Dieser ist bei Reinaldo Macias stimmlich gut aufgehoben, von der Regie wird er leider, wie viele andere auch, ziemlich alleine gelassen, so dass er sich in manch sehr konventionelle Operngeste flüchten muss. Subtil in Spiel und Gesang erlebt man Valdimir Stoyanov als Ränke schmiedenden Jesuiten Rangoni. Rudolf Schasching als windiger Schuiskij und Boguslaw Bidzinski als prophetischer Gottesnarr runden das Ensemble überzeugend ab. Von den vielen kleineren Partien sei besonders die mit warmer Stimme singende Kismara Pessatti als Amme herausgehoben.
Chor und Orchester unter Vladimir Fedoseyev erbrachten nach anfänglichen Koordinationsproblemen in den ersten beiden Bildern eine beachtliche Leistung. Das knorrige, raue und manchmal auch minimalistische Kolorit des Original-Boris wurde vortrefflich herausgearbeitet. Wozu die elektronischen Verstärkungen nötig waren, die zu Beginn und am Ende Einzel- und Chorstimmen zudeckten und fast eine Musical-Theater-Atmosphäre suggerierten, blieb unklar.
„Öde ist alles, ach so öde!“ singt Marina zu Beginn des dritten Aktes. Die Regie hat das stellenweise zu wörtlich genommen. Das Schlussbild allerdings tröstet über vieles hinweg. Wie sich der Zar Boris von seinem goldenen Panzer, dieser schweren Last seines Amtes, befreit und nur noch im weissen Büssergewand am Fusse einer den Thron symbolisierenden Pyramide stirbt, das hatte etwas ungemein Berührendes und zugleich Versöhnliches.
Kurzer, aber herzlicher Applaus für die Solisten und einige unüberhörbare Buhs für das Inszenierungsteam am Ende eines Abends mit musikalischen Höhen und szenischen Tiefen.
Inhalt:
Der unschlüssige, jedoch ehrgeizige Regent Boris Godunow wird dazu gedrängt, sich zum Zar krönen zu lassen, da der Thron nach dem Tode des letzten Zaren verwaist war und der Thronfolger Dimitrij ermordet wurde.
Der junge Mönch Grigorij beschliesst, sich als Zarewitsch Dimitrij auszugeben und sucht beim russischen Erzfeind Polen Hilfe. Marina, eine polnische Adlige, in welche sich der falsche Dimitrij verliebt und der intrigante Jesuit Rangoni gewähren ihm Unterstützung bei seinem Plan, die Zarenkrone an sich zu reissen.
Boris Godunow wird immer öfter von Wahnvorstellungen und Gewissensbissen wegen der Ermordung des Zarewitschs heimgesucht. Die Bojaren beschliessen zwar, den falschen Dimitrij töten zu lassen, Boris Godunow jedoch bricht, dem Wahnsinn nahe, zusammen und stirbt. Die Herrschaft tritt er an seinen Sohn ab.
(In Zürich nicht zu sehen: Der falsche Dimitrij erscheint vor Moskau und wird vom wankelmütigen, hungernden Volk jubelnd als neuer Zar begrüsst. Ein Gottesnarr beklagt das traurige Schicksal Russlands.)
Werk:
Ganz im Stil einer Grand Opéra hat Mussorgskij das private Schicksal seiner Protagonisten mit der Politik verstrickt, ähnlich beklemmend wie Verdi in seinem DON CARLO.
Nachdem in Zürich zuletzt der Ur-Boris von 1869 zu sehen war, hat man sich nun entschieden, den so genannten Original-Boris, mit dem Polen-Akt aufzuführen, aber ohne das abschliessende Revolutionsbild vor Moskau. Einrichtungen und Orchestrierungen dieser Oper Mussorgskijs gibt es auch von Rimski-Korsakow und Schostakowitsch.
Vor allem die farbige, knorrige Harmonik und der Einbezug traditioneller russischer Kirchen- und Volksmusik sowie die Blendentechnik (kurze, kontrastreiche Einzelszenen) machen BORIS GODUNOW zu einem Meisterwerk der Opernliteratur.
Den Polen-Akt prägen nationale Tanzrhythmen (Mazurka, Polonaise) und Anlehnungen an italienische Opern (Partie des Rangoni, Liebesszene).
Die Monologe des Boris im zweiten und vierten Akt gehören zu den Paradestücken grosser Bässe, von Schaljapin über Ghiuselev, Talvela, zu Ghiaurov, Raimondi, und SALMINEN.
Fazit:
Lohnenswerte Begegnung mit dem Original-Boris (leider wurde das Schlussbild gestrichen), sehr gutes Ensemble, von der Inszenierung leider weit gehend im Stich gelassen.
Für art-tv: © Kaspar Sannemann, 28. April 2008